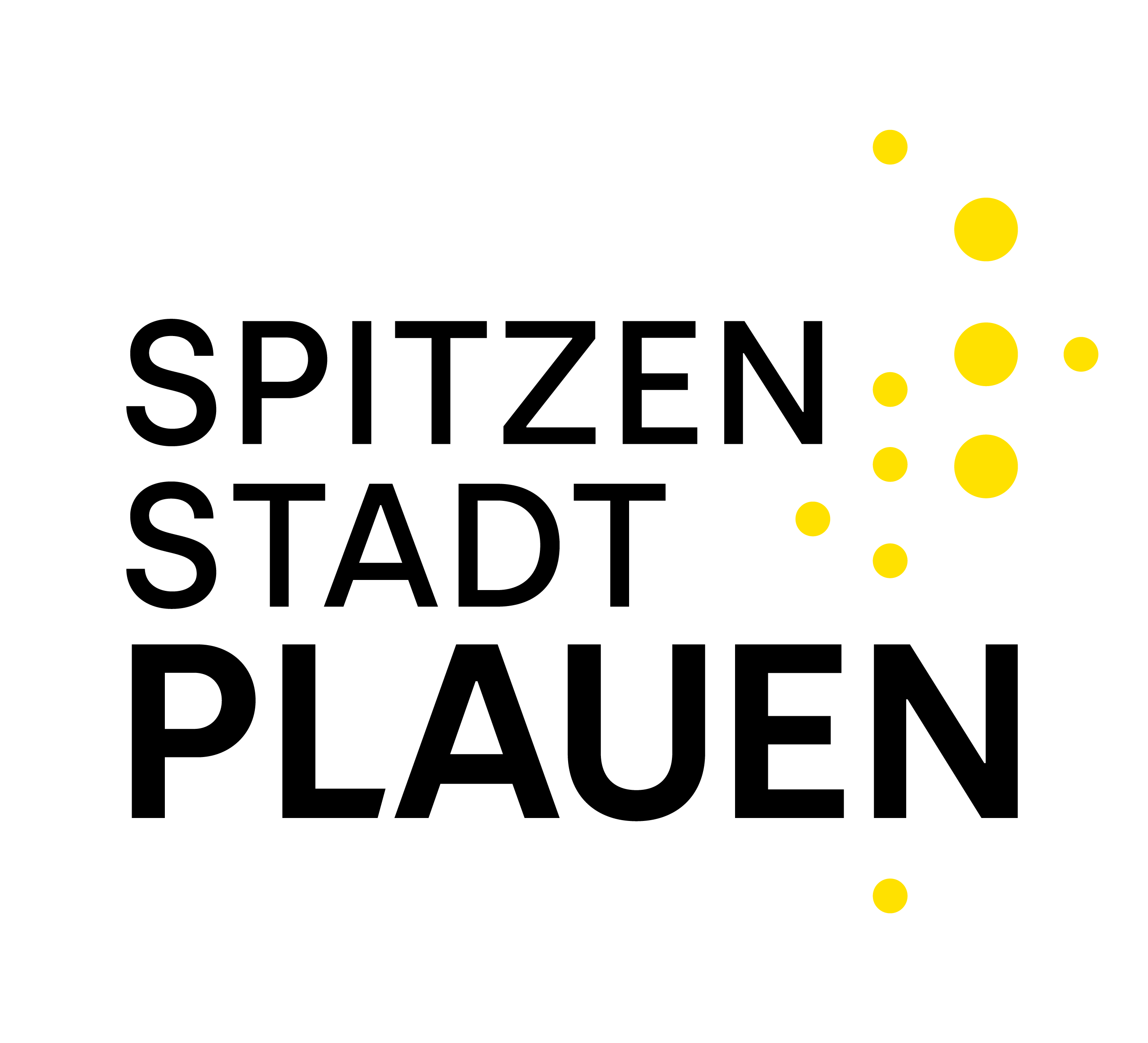Im Jahre 1928 wurde in Jößnitz ein 50 Meter tiefer Brunnen gebaut, nachdem zwei Wünschelrutengänger unabhängig voneinander eine starke Grundwasserquelle festgestellt hatten. Die Wasserqualität war einwandfrei. Ein Pumpenhaus mit 20-cbm-Pumpe und Kontrolltechnik wurde errichtet. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Kabelleitung beschädigt und später entfernt. Der Brunnen versorgte einen Hochbehälter und beendete den Wassermangel im Dorf.
Die Wasserversorgung in Jößnitz, Tiefbrunnen und Wasserwerk
Soweit sich zurückblicken lässt, besaß die Mehrzahl der Häuser, vor allem die Bauerngüter, eigene Brunnen. Diese befanden sich im Hof, Garten oder Keller und waren im Laufe der Jahre technisch vervollkommnet worden z.B. mit Motoren für die Pumpen, teilweise mit selbstständiger Einschaltung, Wasserleitung im Haus oder Viehselbsttränken.
Für die übrigen Häuser waren vier Gemeindebrunnen vorhanden. Einer Ecke Steinsdorfer/Röttiser Straße, der zweite beim unteren Dorfteich, der dritte auf dem freien Platz vor Zahns Fleischerei – jetziger Denkmalplatz und der vierte am Hoogberg am Fuße des Schlossbergs.
Die beiden ersten Brunnen waren bis 1939 in Benutzung. Ihre Bretterschalung diente bei den häufigen Wahlen in der Weimarer Republik meist als Anschlagsfläche.
Der dritten Brunnen wurde aufgegeben, als 1922 das Gelände zur Anlage des Ehrenmals benötigt wurde. Der vierte Brunnen, ein Schöpfbrunnen, blieb schon vor dem ersten Weltkrieg außer Betrieb.
Das Rittergut besaß eine eigene Gefälleleitung. Das Wasser des Kaltenbachs war bei einem Flurstück unterhalb vom Heiteren Blick bei ungefähr 435 m Höhe gestaut und lief dann über Filterbecken in Holzröhren neben dem Bach entlang abwärts, um am Rittergutsberg emporzusteigen und in einen Sammelbehälter zu fließen.
Nachdem um die Jahrhundertwende die Aufschließung des „neuen Viertels“ feststand, ließen die Besitzer des Geländes, die Eigentümer des Ritterguts, eine besondere Wasserleitung bauen. Selbst die im Sommer 1911 erbaute zweite Wasserleitung reichte nicht zu einer ausreichenden Wasserversorgung der Anwohner aus. Die Quellen dieser beiden Sickerleitungen lagen im Gebiet der „Rohfelder“ - jetzige Waldanlage - sowie auf den Flurstücken des „Unteren Thümmlers“. Das Wasser wurde über Leitungen zum Hochbehälter geführt.
Die Gemeinde kaufte diese Wasserleitungen und bemühte sich bei der Stadt Plauen, aus deren Kaltenbachleitung zusätzlich Wasser zu erhalten. Die vertraglich zugesagte Wasserabgabe wurde jedoch nicht immer eingehalten. In trockenen Jahren konnte die Stadt Plauen oft gar nichts abgeben. Auch fehlte meist der Druck, damit das Wasser in den höher gelegenen Hochbehälter lief. Verhandlungen mit der Stadt verliefen ergebnislos und Jößnitz entschied sich für eine eigene unabhängige Wasserversorgung.
Deutschlands bekanntester Wünschelrutengänger Kleinau aus Köthen wurde um ein Gutachten ersucht. Seine zweistündige Arbeit kostete der Gemeinde 500 RM, brachte aber sehr gute Ergebnisse. Im Gelände des Rohrwegs am Sattelbach fand er in den Wiesen einen Wasserstrom mit sehr viel Wasser. Zur Sicherheit bat man einen zweiten Experten um Wünschelrutengänge. Oberlandwirtschaftsrat Dr. Klaus aus Dresden bestätigte, ohne Kenntnis der ersten Forschung, das Vorhandensein eines sehr starken Grundwasserstromes im gleichen Gelände. Er empfahl einen Punkt für einen Brunnenbau und so entstand an dieser Stelle ein Tiefbrunnen, nachdem man das Gelände erworben hatte. Die chemische und bakteriologische Untersuchung ergab das Vorhandensein eines einwandfreien Trinkwassers.
1928 begann man mit der Bohrung des rund 50 Meter tiefen Brunnens. Zum bunkerähnlichen Pumpenhaus, dessen Seiten mit Erde angefüllt wurden, baute man eine Leitung und überprüfte in wiederholt durchgeführten Versuchen, die Ergiebigkeit der Quelle.
Es wurde eine 20-cbm-Pumpe eingebaut. Die elektrisch betriebene Anzeige- und Kontrolltafel konnte im Gemeindeamt abgelesen werden. Leider wurde die Kabelleitung Ende des Zweiten Weltkrieges stark beschädigt, so dass sie 1946/1947 abgebaut wurde.
Das Wasser des neuen Tiefbrunnen und der anderen Leitungen liefen in den neuen Hochbehälter. Es war ausreichend sauberes Wasser vorhanden und der Wassermangel im Dorf war endlich behoben.
Da das Trinkwasser zunehmend eisen- und kohlesäurehaltiger wurde, baute man 1932 neben dem Hochbehälter eine entsprechende Reinigungsanlage.
Durch den Verkauf von ca 45 Hektar Rittergutsfeldern als Siedlungsland im neuen Viertel 1928 nahm die Bautätigkeit in der oberen Siedlung zu und der anliegende Druck reichte für eine gleichmäßige Wasserabgabe nicht mehr aus. Es wurde im Reinigungsgebäude neben dem Hochbehälter eine Hydrophoranlage mit 6 atü Druck eingebaut, später eine Enthärtungsanlage zum Ausfiltern von Kalk.
1938/39 begann in Jößnitz der Leitungsbau bis ins alte Dorf. Neben dem historischen Ortskern musste außerdem das zirka 7 Hektar große neue Erschließungsgebiet um den Totenpöhl mit Wasser versorgt werden. Aber auch für eine effektivere Brandbekämpfung im gesamten oberen Dorf war der schnelle Zugriff auf ausreichend Wasser notwendig. Für das höher gelegene Gebiet um die Kirche herum wurde für die Gewährleistung eines ausreichenden Drucks eine Überdruckanlage sowie zur Reinigung des Wassers eine Hydrophoranlage unterhalb gebaut. Der obere Teich auf dem heutigen Dorfplatz schüttete man zu, die bisher dort eingeleiteten Abwässer der Bauerngüter in einer Schleuse gesammelt.
Durch den Wegfall der bisherigen oberirdischen Abflussrinnen am Straßenrand ergab sich neben der Verschönerung des Straßenbildes eine Verbreiterung der Straße zwischen Spritzenhaus und dem Linsenteich. Der untere Teich wurde mit Trinkwasser gefüllt und als Löschwasserteich genutzt.
Durch die Bombardierung der Wasserversorgungsanlage am 17.03.1945 wurden die zwei Hochbehälter, die Wasserreinigungsanlage und die Pumpstation des Tiefbrunnens außer Betrieb gesetzt. Auch die Stromleitungen waren durch Bombentreffer zerstört, so das erst Anfang Juli 1945 die Pumpstation wieder in Betrieb genommen werden konnte. Die höher gelegenen Häuser hatten dadurch allerdings kein Wasser. Nach dem Krieg bauten die Jößnutzer wegen der fehlenden Lebensmittel überall Gemüse und Kartoffeln an und der Wasserbedarf stieg. Ebenfalls benötigten die zahlreich untergebrachten Flüchtlinge Wasser. Die im Sommer 1947 wieder in Betrieb genommenen Wasserbehälter waren immer leer. Durch einen Gestängebruch in der Pumpe und wiederholte Stromabschaltungen war Trinkwasser nicht immer in ausreichender Menge vorhanden. Die Jößnitzer wurden zum Wassersparen aufgerufen. Wäschewaschen mit Leitungswasser war verboten. Erst ab dem 14. Mail 1948 war die Wasserversorgung der Gemeinde mit ausreichend Wasser wieder gegeben, wozu die neue Brunnenverrohrung ebenfalls beitrug.
Nach 1990 begann man mit umfangreichen Maßnahmen zur Wasserentsorgung. In 25 Bauabschnitten wurde das gesamte Kanalnetz erneuert, bis 2002 das unterirdische Regenrückhaltebecken am Hetschenberg in Betrieb genommen wurde. Eine Abwasserdruckleitung pumpt das Abwasser zur Kläranlage nach Plauen. Neben der Erneuerung des Trinkwassernetzes vollzog sich die Errichtung eines neuen Wasserwerkes mit Wasserbehälter an der Robert-Koch-Straße.
Quellen:
Broschüre 700 Jahre Jössnitz
Festzeitschrift zum ersten Heimatfest 1956
Dorfchronik Jößnitz 1997
Festschrift 750 Jahre Jößnitz 2013